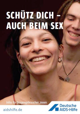Vielfalt der Themen und Ideen im Fokus
Bericht von der Veranstaltung "Prävention konkret" am 01.04.25 in Frankfurt

Seit 2022 arbeiten die hessischen Aidshilfen an der Umsetzung von Empfehlungen der Studie „95 – 95 – 95 – 0 – Ziele der HIV-Prävention“. Diese Evaluation hat untersucht, welche Maßnahmen verbessert oder neu ergriffen werden können, um die Prävention von HIV zu stärken und die Versorgung von Menschen, die mit HIV leben, zu verbessern. Unterstützt wird die Arbeit an der Umsetzung durch das Landesgesundheitsministerium. Hintergrund sind dabei auch globale Ziele der Organisation UNAIDS, deren Erfüllung eine Bewältigung der HIV-Epidemie bis 2030 ermöglichen soll. Hessen unterstützt diese Ziele aufgrund eines Landtagsbeschlusses von 2021.
Seit der Veröffentlichung der Studie hat der Landesverband der Aidshilfen mehrere Fachtage organisiert, die die Handlungsfelder beleuchten, relevante Akteur*innen vernetzen und die Umsetzung von Maßnahmen vorbereiten. Die jüngste dieser Veranstaltungen fand am 01.04.2025 unter dem Titel „Prävention konkret“ an der Frankfurt University of Applied Sciences statt (UAS). Die Hochschule trat auch als Mitveranstalterin des Tages auf. Mehr als 70 Menschen, Vertreter*innen von Aids-, Sucht- und Selbsthilfe, Gesundheitsämtern und Verwaltung sowie weitere Interessierte, kamen zusammen.
Ziel war die Initiierung von Aktivitäten, die in den hessischen Regionen möglichst bald umgesetzt werden können – pragmatisch und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, die von HIV besonders bedroht oder betroffen sind.
Zusammenhang von gesundheitlicher und sozialer Situation
In den Tag leiteten Dr. Katharina Böhm, Geschäftsführerin der Hessischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung (HAGE), und Mario Ferranti, Geschäftsführer der Aidshilfe Marburg, ein. Die Vorträge beleuchteten die sozialen Determinanten von Gesundheit. Böhm stellte Daten zum Zusammenhang von Lebenserwartung und sozialer Deprivation vor. Zudem referierte sie wesentliche theoretische Konzepte der wissenschaftlichen Literatur zum Zusammenhang von sozialer Lage und individueller Gesundheit. Schließlich appellierte sie für eine Stärkung von Präventionsbemühungen – vor dem Hintergrund, dass Deutschland im europäischen Vergleich sehr hohe Gesundheitskosten je Einwohner hat – bei schlechteren Ergebnissen. Prävention entlaste in diesem volkswirtschaftlichen Zusammenhang.
HIV und die Verknüpfung von Stigmatisierungen
Ferranti bot eine Zusammenfassung des Konzepts der strukturellen Prävention, das Aidshilfen seit Gründung in den 1980er Jahren entwickelt haben. Dieses Konzept berücksichtigt die Tatsache, dass Menschen, die in Deutschland von HIV/Aids bedroht oder betroffen sind, besonders häufig zu gesellschaftlich ohnehin marginalisierten Gruppen zählen: Schwule, Drogen gebrauchende Menschen („Junkies“) und Menschen aus Ländern mit höherer Prävalenz. Die Strategie der Aidshilfen umfasst daher, den Angehörigen dieser Gruppen die Chance auf ein besseres Selbsterleben zu bieten. Damit soll den Erfahrungen von Abwertung durch Diskriminierung etwas entgegengesetzt werden – da die Motivation und Fähigkeit zur Selbstsorge nicht vom Selbstwertgefühl getrennt werden kann. Entscheidend ist zudem die pragmatische Weitergabe von Informationen und Materialien zu Schutz und Schadensminimierung z. B. beim Sex oder Substanzkonsum.
Ein Checkmobil für Testungen in der Fläche
Nach den Vorträgen und der Diskussion hierzu teilte sich das Plenum in vier Workshops auf. Eine Gruppe beschäftigte sich mit der Möglichkeit mobiler Testangebote. Das „Checkmobil“ aus Schleswig-Holstein konnte vor Ort auf dem Hof der Hochschule besichtigt werden. Projektleiterin Louisa Glaum berichtete von der Arbeit: Das Checkmobil versorgt durch Tageseinsätze an diversen Standorten des Landes „vulnerable Personen“ (z. B. Drogen Gebrauchende und Wohnungslose) mit Angeboten von Tests auf HIV und Hepatitiden. Eine notwendige Behandlung konnte in vielen Fällen initiiert und unterstützt werden. In Hessen besteht aktuell kein vergleichbares Angebot. In einigen Regionen des Landes gibt es aber nur wenige anonyme und niedrigschwellig zugängliche Testangebote. Im Workshop wurden Bedarfe und Umsetzungsideen für mobile Angebote besprochen.
Safer Use ist auch Thema außerhalb der Großstadt
2024 hat die Aidshilfe Hessen das Projekt „Präventionsautomaten“ gestartet. Es soll die hessenweite Verteilung von Utensilien für den schadensminimierenden Safer Use von Substanzen und Safer-Sex-Utensilien unterstützen. Aus Anlass des Projektstarts informierten der Koordinator Christian Rosner und Bernd Werse, Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt UAS, mit einem Workshop „Safer Use im ländlichen Raum“. In den Impulsen wurde deutlich, dass der wissenschaftliche Kenntnisstand über Substanzverbreitung und Konsummuster außerhalb der Metropolen noch gering ist. Tatsache ist aber, dass Konsument*innen im gesamten Bundesland leben. Aufgrund des Mangels an niedrigschwelligen Unterstützungsangeboten in vielen Regionen fällt einem Teil von ihnen eine gänzliche Lösung von der Szene in Frankfurt schwer, was auch die dortigen Probleme verschärft. Präventionsautomaten gehören zu den Maßnahmen, die hier eine gewisse Abhilfe schaffen könnten, zudem würden sie helfen, Neuinfektionen zu vermeiden.
Spezifische Prävention im migrantisch geprägten Hessen
Die Studie „Ziele der HIV-Prävention“ enthält Empfehlungen für eine verbesserte Versorgung von Migrant*innen mit Präventionsangeboten. Im Workshop „Präventionsangebote für migrantische Communities“ mit Pierre Mayamba (Sozialarbeiter bei der Aids-Hilfe Essen) und Nina Baghery (Referentin für „Leben mit HIV“ bei der Aids-Hilfe Hessen) wurde diese Forderung zunächst mit einer sorgfältigen Begriffsbestimmung konfrontiert. Hingewiesen wurde dabei unter anderem auf unterschiedliche Aufenthaltsstatus mit den einhergehenden Hürden beim Zugang zum Gesundheitswesen und Formen rassistischer Diskriminierung, die sich mit der Thematik HIV verschränken können. Unterstrichen wurde auch die Bedeutung spezifischer Präventionsangebote vor dem Hintergrund, dass Hessen das Flächenland mit dem höchsten Anteil von Menschen mit sog. „Migrationshintergrund“ ist, und ein hoher Anteil der Neuinfektionen Menschen, die zugewandert sind, betrifft. Inspiriert von Mayambas Bericht über die Arbeit des Projekts „Missa NRW“ konnten die Teilnehmenden im Anschluss eigene Überlegungen zur Gestaltung von Präventionsangeboten entwickeln.
Sensibilisierung der Pflege nötig
Aidshilfe betrachtet Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention als eine Einheit. Daher sollte im Kontext eines Tages zur Prävention nicht nur die Verhinderung von Neuinfektionen, sondern auch die Verbesserung der gesundheitlichen Situation von Menschen, die mit HIV leben, betrachtet werden. Eine Herausforderung der nächsten Jahre ist dabei die Tatsache, dass der Anteil älterer Menschen, die mit HIV leben, immer größer wird. Bereits heute ist die Mehrheit der Menschen, die in Deutschland mit HIV leben, über 50 Jahre alt. Im Workshop „HIV im Alter“ stellte Kerstin Mörsch von der Kontaktstelle HIV-bezogene Diskriminierung der Deutschen Aidshilfe vorläufige Ergebnisse einer Befragung älterer Menschen mit HIV vor. Hier zeigte sich, dass die Befragten gesundheitliche Einschränkungen oft nicht mit der Tatsache der Infektion in Verbindung bringen. Relativ viele geben zudem an, gute Vorsorge betrieben zu haben. Als eine Belastung wird aber Isolation bzw. Einsamkeit gesehen. Pflegeleiter Volker Wierz aus Berlin referierte zudem über medizinische Herausforderungen im Kontext HIV und Alter sowie die bislang insgesamt mangelnde Sensibilisierung von Pflegeeinrichtungen. Anzuknüpfen wäre in Hessen etwa bei der Gestaltung der Curricula der Pflegeschulen.
Intensivere Zusammenarbeit von Aidshilfen und Strafvollzug im Rahmen eines Pilotprojekts
Zum Abschluss des Fachtages wurde im Rahmen eines großen Podiums auf ein besonderes Arbeitsfeld der Prävention hingewiesen: Die Situation von Menschen in Haft. Viele von ihnen gehören zu Gruppen mit erhöhten Prävalenzen von HIV und Hepatitiden. Es bestehen Verknüpfungen zum Thema Substanzkonsum und seinen Bedingungen im Haftkontext und der Stigmatisierung von Lebensweisen. Als zentralen Gast begrüßte der Fachtag Tanja Eichner, Staatssekretärin im Hessischen Ministerium der Justiz und für den Rechtsstaat. Fachkundige Auskunft über die medizinische Versorgung in Haft, insbesondere auch im Kontext Suchtmedizin, bot zudem Dr. Simone Dorn, ltd. Medizinaldirektorin im Justizvollzug. Im Austausch mit Selbsthilfevertreterin Claudia Ak, Wissenschaftlerin Maike O’Reilly (u. a. Frankfurt UAS) und Dirk Schäffer, Referent für Drogen und Strafvollzug der Deutschen Aidshilfe, wurden gemeinsame Einschätzungen und Unterschiede deutlich. Insbesondere zur Aidshilfe-Empfehlung, im Haftkontext sterile Konsumutensilien zur Verfügung zu stellen, konnte keine Einigkeit wahrgenommen werden. Allerdings sollen der hessische Strafvollzug und die Aidshilfen in Zukunft wieder enger zusammenarbeiten. Zum Beispiel durch das Angebot von Workshops in einer Justizvollzugsanstalt und sozialarbeiterischer Unterstützung beim Übergang in die Freiheit. Im Anschluss an eine Haft sind die medizinische Weiterversorgung und der Krankenversicherungsschutz oftmals nicht gegeben. Hier soll Aidshilfe Unterstützung für Betroffene leisten.
Eine ausführliche Dokumentation der Veranstaltung wird im Laufe des Sommers veröffentlicht.

Florian Beger
Landesgeschäftsführer
Teilen auf